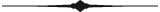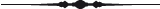Miriam Schaaf schneidert die Ballkleider für die modernen Monarchen. Was die Prinzessin trägt, überlässt die Designerin aber lieber anderen.
WeiterLediglich die Silhouette ihrer männlichen Models, die an zart gebaute Skispringer erinnert, steht als dezenter Hinweis an Miriam Schaafs ersten modischen Berührungspunkt: An der Nähmaschine ihrer Mutter, die in den 80er Jahren in ihrer Freizeit Skianzüge nähte, entwickelte sie die Faszination für Mode und Schnitte. Die aktuelle Kollektion der Münchner Jungdesignerin ist nicht für den Sport unter freiem Himmel, sondern für dunkle Gewölbe gedacht. Auf dem Laufsteg der Beck’s Fashion Experience präsentierte sie in diesem Frühjahr düstere Drachentöter, um deren schlanke Körper sich märchenhafte Umhänge ranken. Ihre androgynen Prinzen sind der Traumwelt kleiner Mädchen entsprungen. Sie tragen ein Diadem im Haar, eine wallende Schleppe und Paillettenweste, die das moderne Dornröschen ebenso stattlich kleiden könnten. Miriam Schaaf sieht die heutigen Traumprinzen als Helden mit Gitarre und designt nicht nur für mutige Männer, sondern besonders für Bühne und Musik.
Nach Schneiderlehre und Schnittausbildung hat Miriam Schaaf an der AMD München studiert und mit Ute Ploier, die ebenfalls für Männer entwirft, in Wien gearbeitet. Ihre Diplomkollektion hat sie bei der Beck’s Fashion Experience 2009 als eines von sieben viel versprechenden Designtalenten präsentiert. Im Interview spricht sie mit uns über ihre Arbeit als Mens-Wear-Designerin.
BLANK: In Berlin hast du bei der Beck’s Fashion Experience nur die Männerstücke deiner Kollektion präsentiert. Wo hast du die Entwürfe für die Frauen versteckt?
Miriam Schaaf: Ich wollte von vorneherein nur Männersachen machen, musste aber von meiner Schule aus für Männer und Frauen entwerfen. Die Frauenstücke habe ich für die Show in Berlin rausgeschmissen und dann gemerkt, dass die Männersachen gar nicht mehr so gut zusammen passten, da die Frauenteile das Bindeglied zu den anderen Entwürfen waren. Daraufhin habe ich die Männerkollektion noch einmal neu und rein in schwarz-weiß genäht.
BLANK: Woher rührt deine Liebe zur Männermode?
MS: In erster Linie ist das intuitiv, ich habe eine Affinität dafür und es ist für mich einfacher, wenn ich eine Distanz zu der Person habe, die ich einkleide, als wenn das eine Frau ist, in die ich mich hineinversetzen kann.
BLANK: Deine Entwürfe spielen dennoch mit der weiblichen Seite des Mannes und übertreten die Grenze zu femininer Schnittführung.
MS: Auf jeden Fall, ich habe auch die komplette Kollektion schon einem Mädchen angezogen und es hat super gepasst. Die Männer müssen noch ein wenig zu mutigerer Mode erzogen werden, aber ich glaube, im Moment wächst eine Generation heran, die unheimlich modeinteressiert ist. Ich empfinde das in München als extrem. Dort sind die männlichen Modefans in den letzten drei bis vier Jahren zuhauf aus dem Boden gesprossen.
BLANK: Auf den Laufstegen werden auch die Männer immer dünner, um die schmalen Schnitte der Designer tragen zu können. Ist das Körperbild des Mannes ebenfalls einem Wandel unterzogen und von Mode diktiert?
MS: Definitiv. Ich habe meine Sachen auch an ziemlich krassen Hungerhaken gefittet.
BLANK: Was machen nun die Männer, die ihren Hungerhaken-Maßen mit 30 entwachsen?
MS: Die ziehen das Ganze dann in Größe M oder L an. (lacht)
BLANK: Wolfgang Joop hat vor kurzem gesagt, er fände das Männerbild auf den Laufstegen entwürdigend: „Es entsexualisiert den Mann, macht ihn zum entseelten Objekt.“
MS: Tatsächlich? Ich denke – und das gilt auch für Frauen – dass die Körperbilder der Laufstege dorthin gehören und die Übertragung in den Alltag so nicht stattfinden muss. Warum sollten zudem Männer immer männlich sein müssen? Frauen dürfen dünn und androgyn sein und gelten immer noch als schön. Von daher sollte Joop seine Männlichkeit vom Model-Geschmack der Designer nicht bedroht sehen.
BLANK: Wie sehen die Männer aus, die du einkleiden möchtest?
MS: „Meine Männer“ sind in der Kunst und Musik verortet. Meine Entwürfe erinnern ganz bewusst an Bühnenoutfits.
BLANK: Die Namensgebung deiner Kollektionen sind stark durch Musikzitate, Songtitel und Bands inspiriert, über die Musikkultur hinaus spielst du aber auch mit Elementen des Eskapismus. Weckt unsere heutige Welt bei dir den Wunsch nach Realitätsflucht?
MS: Sicher, und Mode und Kunst sind für mich die richtigen Orte dafür. Ich bastle mit meinen Entwürfen gerne selbst eine Traumwelt, in die ich mich flüchte, wenn ich denke, mir wird gerade alles zuviel.
BLANK: Du entwirfst auf der einen Seite den Prinzen, der Stärke demonstriert und dafür steht, das Burgfräulein aus dem Turm zu retten. Auf der anderen Seite arbeitest du mit starken femininen Einflüssen bei den Männern, lässt sich das überhaupt gut vereinen?
MS: Klar. Das Bild vom Prinzen ist eigentlich ein Bild ist, wie sich kleine Mädchen ihren Traumprinz vorstellen und das sind die Gedanken, die ich zitieren wollte. Meine Jungs sehen aus, wie man sich als kleines Mädchen einen Prinzen vorstellt. Sie sind knabenhafter und bauen auf mädchenhaften Ideen auf.
BLANK: Was für Reaktionen bekommst du von Männern?
MS: Von Schwulen bekomme ich sehr positive Reaktionen, von Heteros seltener. Dafür habe ich aber bereits eine Lösung: Meine Kleider sind so konzipiert sind, dass man die extravaganten Teile abnehmen kann. Mein Freund ist kein experimentierfreudiger Modetyp und kann meine Sachen trotzdem tragen.
BLANK: Planst du nun eher in Richtung Bühnenoutfits und Bands als in Richtung eines klassischen Labels?
MS: Die Verbindung zwischen Musik und Mode ist mir sehr wichtig. Es ist vielleicht sogar mein größter Traum, nur Kollektionen für Musiker zu machen und Kostümbildner für Künstler zu sein. Ich muss mir nun Bands aussuchen, die in meine Mode „reinpassen“. Ich würde unheimlich gerne Bands ausstatten, und es gibt auch schon erste Kontakte. Am liebsten würde ich die Black Angels anziehen, das ist in Moment meine absolute Lieblingsband und ich finde sie könnten auch neue Outfits vertragen. (lacht) Ich glaube, die wollen nicht unbedingt eine modische Band sein, aber das könnte ich ganz dezent machen. Den Sternen würde ich vielleicht auch neue Outfits verordnen. Junge Bands haben meistens mittlerweile ihre Modeberater, aber die ältere Generation lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig.
BLANK: Du nennst unzählige Musiker als deine Inspiration. Was ist musikalisch dein größter Einfluss?
MS: Für meine Diplomkollektion waren es Tocotronic. Ich war etwas verzweifelt, da ich unter Druck stand ein Inspirationsthema präsentieren zu müssen. Zumeist habe ich schon im Vorfeld ein Thema, aber ich vermische es immer noch gerne mit drei anderen und zu dem Zeitpunkt wurde das „Manifest“ zum bevorstehenden Tocotronic-Album veröffentlicht. Ich habe das im Radio gehört, hatte sofort ein Bild vor Augen, wie ich das umsetzen könnte und wusste: „Das ist es!“ Den Begriff der Kapitulation modisch umzusetzen, fand ich extrem spannend, weil es genau in der Mode eigentlich immer darum geht zu zeigen, wie unglaublich toll man ist, wie gut man aussieht. Ich wollte dazu ein Gegenstatement zu setzen. So war es in dem Fall weniger das Album oder die Musik, die mich inspiriert haben, sondern eher das Manifest.
BLANK: Das klingt beinahe politisch. Dennoch: begab man sich in den letzten Wochen auf die Modewochen überall in der Welt, war von Finanzkrise und ihrer künstlerischen Aufarbeitung wenig zu spüren.
MS: Es ist etwas absurd, die Fashion Week ertränkt sich im Glamour. Die Mode zelebriert sich im Eskapismus. Aber es muss ja Bereiche geben, in denen man nicht in Panik verfällt und zu dem steht, was man kann.
BLANK: Welche Designer haben dich während der Fashion Week in Berlin begeistert?
MS: Als Mens-Wear-Designerin fand ich natürlich Julia Kim bei der Beck’s Fashion Experience sehr spannend; obwohl sie komplett anders als ich arbeitet, hat sie den gleichen Anspruch aus etwas Klassischem etwas Neues zu entwickeln. Sie findet dafür fantastische Lösungen. Und sonst? Ich kenne mich nicht so aus mit Frauensachen, die interessieren mich einfach nicht so. (lacht) Ich bin daher mit meiner eigenen Garderobe ein bisschen nachlässig. Ich gehe ganz selten einkaufen, und wenn, dann meistens in einer totale Krise: Ich denke, scheiße – ich bin doch Modedesignerin, ich muss mich besser anziehen. Aber meistens laufe ich in Jeans und T-Shirt rum.
BLANK: Was hast Du von deiner Arbeit mit Ute Ploier in Wien mitgenommen?
MS: Ich habe große Sprünge gemacht, zumindest im Kopf. Ich hatte bei Ute Ploier erst einmal gemerkt, was es heißt, Designer zu sein. Dass es wirklich in erster Linie einmal auf die Organisation ankommt, und dass „Kollektion machen“ eigentlich nebenbei passiert. Wenn man kurz fünf Minuten Zeit hat, überlegt man sich, wie mach ich eigentlich diese Saison die Hemden? Das professionelle Arbeiten, die Organisation und auch gegen Stress resistent zu sein, habe ich auf jeden Fall von Ihr gelernt.
BLANK: Welche Themen werden deine nächste Kollektion bestimmen?
MS: Ich fange gerade an mich mit „Moby Dick“ zu beschäftigen und habe parallel dazu die Black Angels im Ohr. Es wird wohl eine Fusion aus beiden Einflüssen, zudem sehr hell, wohl weniger typisch für mich, aber für den Sommer.
BLANK: Glaubst du, die Männer brauchen noch ein Mal einen starken, modischen Appell um sich mutiger zu kleiden?
MS: Nein, den brauchen sie nicht. Ich glaube, sie finden von allein zur Mode. Sie beziehen Einflüsse aus Musik und dem Netz. Vor ein paar Jahren war es einfach nicht möglich sich umfassend über Mode zu informieren. Mittlerweile ist es so leicht geworden; man erkennt kaum noch Unterschiede ob jemand in einer Großstadt wohnt oder aus der Provinz kommt.
Teresa Bücker & Sophia Hoffman