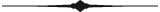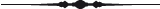von Stefan Kalbers
Die Ampel steht eindeutig auf Rot. Schon vor vierhundert Metern war das ohne jeden Zweifel klar ersichtlich. Ich wage vorsichtig darauf hinzuweisen, eine Spur zu leise vielleicht. Ich weiß nicht, ob Uwe mich auf dem Beifahrersitz überhaupt wahrnimmt. Wir rasen mit 110 Stundenkilometer in einer Vorstadtgegend auf die Kreuzung zu. Ich schließe beide Augen. Etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Wir könnten seitlich gerammt werden und beide tot sein. Wir könnten einen Unfall verursachen, sterben und andere mit in den Tod reißen. Wir könnten diesen Unfall aber auch schwerstbehindert überleben. Querschnittsgelähmt, im Rollstuhl, ans Bett gefesselt, Arm oder Bein verlierend und dabei noch andere, Unbeteiligte mit ins Verderben stürzen. Als ich die Augen drei Sekunden später wieder öffne, sind wir schon über die Kreuzung. Es ist kurz nach halb elf an einem Montagabend. Der Verkehr hält sich in Grenzen.
An das Gute glauben bedeutet, sich darüber klar zu werden, dass man einer bestimmten Situation haltlos ausgeliefert ist. Von allen üblen Konsequenzen tritt einem die schlimmstmögliche klar vor Augen. Aber wer von uns ist schon gern machtlos ausgeliefert? Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. An das Gute zu glauben bedeutet, sich mit großen Schritten über die Vernunft hinweg zu setzen. Sich dümmer zu stellen, als man ist. Wenn man kurz davor ist, verrückt zu werden oder zu verzweifeln, stellt sich dieser Glaube von ganz allein ein. Und wer weiß? Wenn man nur fest genug daran glaubt – vielleicht stellt sich dann auch das Gute von ganz allein ein?
Uwe ist stark alkoholisiert. Ein Wunder, dass er die Kontrolle über den Wagen noch nicht verloren hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kralle meine Finger in den Sitz, danke den Autoherstellern für die Erfindung des Gurtes und die Einführung des Airbags, auch für den Beifahrer.
Dabei fing der Tag gar nicht so schlecht an. Bei der Arbeit war endlich Gelegenheit, die Überstunden abzufeiern. Anstatt wie ein Sklave dem Befehl des Weckers Gehorsam zu leisten, war ich bis kurz nach dreizehn Uhr im Bett liegen geblieben. Die einzige Verpflichtung des Tages war ein Termin beim Zahnarzt gewesen. Folgsam machte ich mich auf den jährlichen Kreuzweg, um die Eintragung ins Bonusheft der Krankenhasse vornehmen zu lassen. Niemand sollte mir vorwerfen können, ich kümmere mich nicht um meine Zähne und sei es auch nur einmal im Jahr. Im Wartezimmer meines Zahnarztes stand ein Aquarium. Einer der Fische trieb mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche. Obwohl ich weiß, dass man das nicht machen soll, klopfte ich mehrmals kräftig gegen die Scheibe. Vielleicht schlief er ja bloß. Nach zwei Minuten permanenten Klopfens war ich mir aber relativ sicher, dass er tot war. Der Fisch war ein Fingerzeig des Schicksals, davon war ich überzeugt. Schon hörte ich im Geist meine eigenen Schreie aus dem Behandlungszimmer. Eine Blutfontaine schoss aus meinem Mund gegen die Decke und ich hörte den Zahnarzt sagen: „Komisch, dass die Spritze gar nicht wirkt“, während die Assistentin versuchte, meine versehentlich abgetrennte Zunge vom Boden aufzuheben und abzuwaschen. Dann wurde über die Lautsprecheranlage mein Name aufgerufen. Ich glaube gern an das Gute, wollte aber in diesem Fall auf Nummer sicher gehen, zog meine Jacke wieder an und schlich aus der Praxis. Auf dem Heimweg meinte ich erstmals seit Jahren ein Ziehen in der unteren Mundpartie zu spüren. Dass sich ausgerechnet jetzt ein Loch im Zahn bemerkbar machen sollte, war lachhaft unwahrscheinlich. Möglicherweise war es aber ein Krebsgeschwür im Unterkiefer. Auf diesen schreckhaften Gedanken zündete ich mir erst mal eine Kippe an. Wenn ich Krebs im Unterkiefer haben sollte, konnte mir der Lungenkrebs auch nichts mehr anhaben.
„Hier muss es irgendwo sein“, sagt Uwe. „Kannst du die Straßennamen lesen?“ Dabei blickt er hektisch um sich. Ich mache mir erst gar nicht die Mühe zu antworten, er würde doch nicht auf mich hören. „Ich bring den Typen um“, schreit Uwe. „Ja ja“, denke ich, aber genau um das zu verhindern, bin ich mit in den Wagen gestiegen. Was war passiert? Eine Frau war schwanger geworden. Nichts Ungewöhnliches, sollte man meinen. Uwe sah das allerdings anders.
„Mensch, freu dich doch“ hatte ich gesagt und hätte dafür fast eine Ohrfeige kassiert.
„Sie ist 57“ hatte Uwe geschrieen. „Na und?“ „Und sie ist meine Mutter!“
„Dann kriegst du eben einen Bruder“, hatte ich resümiert.
„Ich will keinen Bruder! Und meine Mutter auch nicht!“
Nun, streng genommen bekam die Mutter ja auch keinen Bruder. Das behielt ich aber für mich, musste ich doch einsehen, dass Uwe im Moment geistig nicht ganz zurechnungsfähig war.
„Dieser Typ, wie heißt er doch gleich?“ fragte ich.
„Hans!“ brüllte Uwe. Aus seinem Mund klang es fast wie „Hass.“
„Also, vielleicht sollte Hans…“
„Dieser Mutterficker!“ schrie Uwe.
„… das mit deiner Mutter besprechen, ohne dass du den beiden reinredest.“
„Auf welcher Seite stehst du eigentlich?“ Sprachs und griff nach den Autoschlüsseln.
Ich stehe auf der Seite der Paranoia, auf der Seite des Misstrauens, welches in einer Realität, die sich ständig zu verschieben scheint, eine legitime Vorsichtsmaßnahme verkörpert. Ich stehe auf der Seite der konservierten Enttäuschung, die eine Schutzhaltung darstellt, wenn man dünnhäutig geboren wurde und heftiger Anfeindung ausgesetzt war. Ich stehe auf der Seite von Grau, weil die Welt nicht nur weiß oder schwarz ist, sondern immer ambivalent. Abgesehen davon. Warum soll ich mich für eine von zwei Seiten entscheiden müssen? An das Gute glauben bedeutet manchmal vielleicht auch, sich in ein Auto zu setzen und abzuwarten, ob man noch gebraucht wird.
Hans unterdessen läuft in seiner Wohnung auf und ab. Muss er dringend auf die Toilette? Nein! Er ficht einen Kampf mit seiner inneren Stimme aus, die da spricht: „Hat dir Geschlechtsverkehr eigentlich jemals einfach nur Spaß gemacht? Immer dieser Stress mit der Verhütung. Aus Angst vor der mystisch verklärten Vaterwerdung hast du stets auf ein Kondom bestanden. Du hast es noch nie ohne gemacht, außer mit dir selbst. Das hat man dir immer krumm genommen. Du könntest nicht vertrauen, hieß es. Sie nehme extra für dich die Pille, hieß es. Während deine Kumpels Streit bekamen, weil sie n i e einen Gummi benutzen wollten, gab es bei dir Streit, weil du i m m e r auf einen Gummi bestanden hast. Dann kam das Misstrauen, ob du etwa fremdgehen würdest. Es folgten harte Diskussionen. War der Gummi dann durchgesetzt, plagten dich Geschichten, die du gehört hattest. Man könne mit einem Nadelstich im Vorfeld oder durch den geschickten Einsatz von Zähnen während des Aktes die Vaterschaft doch noch erzwingen. Trotz Gummi. Von da ab hast du nur noch auf den Hintereingang bestanden und als Folge davon bist du Single geblieben. Bis vor kurzem. Jetzt glaube doch einmal an das Gute, hast du dich selbst ermahnt. Glaub an die Liebe. Glaub an das späte Glück. Hör einmal auf, so misstrauisch zu sein. Die Frau hat ihre Wechseljahre längst hinter sich. Dachte ich zumindest. Und jetzt das. Dieses biologische Wunder. Am besten bringe ich mich um.“
Dann klingelt es an der Wohnungstüre. „Wer kann das sein?“, fragt sich Hans, drückt auf den Öffner und geht nachschauen.
„Ich habe ihn!“, schreit Uwe und drückt auf die Klingel. Kaum gibt der Summton die Türe frei, sprintet er bereits die Treppe nach oben. Uwe ist Einzelkind. Teilen hat er nie gelernt. Seit sein Vater gestorben ist, sieht er sich als neuer Mann im Haus. Dass seine Mutter auch ein Privatleben hat, gut ohne ihn zurechtkommt und über seine Beschützerhaltung milde lächelt, ist leider nie bis zu ihm vorgedrungen. Alles was Uwe sehen kann, ist ein fremder Mann, der die Familie kaputtmachen will. Aber er glaubt an das Gute. Vielleicht ist das Kind so stark behindert, dass seine Mutter freiwillig abtreiben wird. Vielleicht kann er den Typ so geschickt ins Jenseits befördern, dass es wie ein Unfall aussieht und man ihn nicht belangen kann. Alles soll bleiben wie es ist. Denn so wie es ist, ist es gut. Daran glaubt Uwe und streift sich den Schlagring über.
Die Mutter unterdessen schaut auf die Uhr. In fünf Minuten wird sie Hans anrufen und damit gleichzeitig auch ihren Sohn erreichen. Es war höchste Zeit, dass die beiden sich kennen lernten. Die beiden Männer waren schon jeder für sich eine Festung aus Misstrauen. Dass es hier ohne Konflikte nicht gehen würde, stand von Anfang an fest. Doch sie glaubt fest daran, dass Uwe und Hans gut miteinander auskommen werden. Ich habe keine Lust mehr, allein zu sein. Und Uwe muss endlich selbstständiger werden. Raus aus der Bude. Eine Veränderung muss her, denn Veränderung ist gut. Daran glaubt Uwes Mutter. Sie greift zum Hörer, bereit, ihre Notlüge aufzudecken. Zur Abwechslung könnten doch die Dinge auch mal so gut ausgehen wie im Märchen. Und wenn sie nicht alle gestorben, unglücklich zerbrochen oder abgrundtief enttäuscht sind, dann leben sie noch heute.